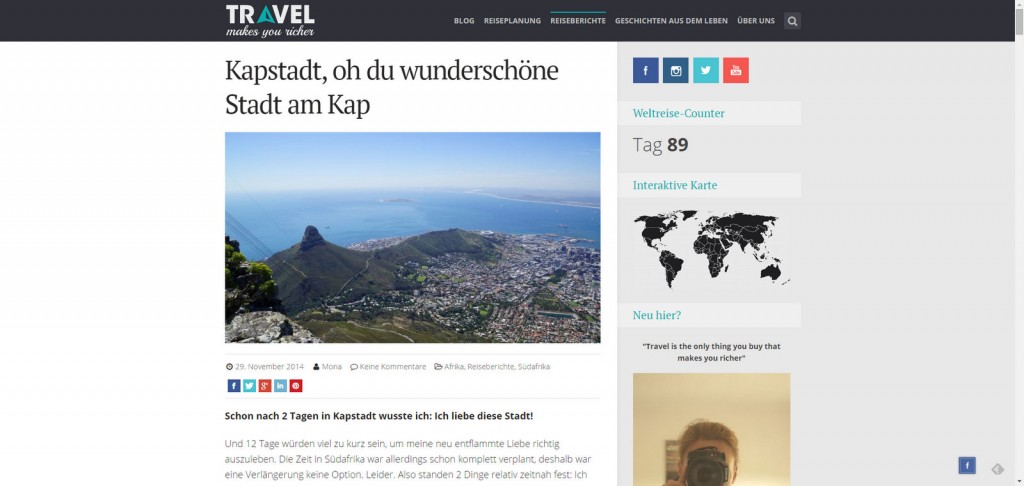Es war vor anderthalb Jahren, in einem Dorf irgendwo südlich von Kassel mitten im Knüllgebirge. Natürlich gab es einen Grund, weswegen wir hier waren, man ist ja eher selten im Herbst in einem Hotel in einem Dorf südlich von Kassel mitten im Knüllgebirge. Aber die Schwiegereltern feierten Goldene Hochzeit und dafür hatte man sich dieses kleine Dorf ausgesucht. Nur die nächsten Verwandten, dafür aber mehrere Tage lang mit Rahmenprogramm. Das Rahmenprogramm bestand aus einer Planwagenfahrt, die erstaunlich schön war und einem Besuch der örtlichen Kegelbahn.
Die Schwiegermutter hatte sich ein Klavier gewünscht, also nicht als Geschenk, sondern für die Feierlichkeiten. Klar, hatten die Hotelbesitzer gesagt, stellen wir Ihnen hin. Das Klavier, so stellte sich raus, war das Klavier vom Hotelbesitzersohn. Die Hotelbesitzer wohnten direkt angrenzend und irgendwann ging eine Tür auf und der Hotelbesitzersohn rollte das Klavier aus der Hotelbesitzerwohnung ins Hotel.
Da stand es nun und wurde regelmäßig bemüht, meistens vom Mann, manchmal von mir, selten von anderen. Für den Abend der offiziellen Feierlichkeiten hatte sich Schwiegermutter musikalische Begleitung gewünscht und wir hatten sogar noch schnell ein lustiges Lied geschrieben, das dann mit Klavier, Ukulele und Gesang vorgetragen wurde. Der Abend wurde später und später, so langsam gingen alle ins Bett, nur der Mann und ich waren noch da. Der Mann und ich, der Hotelbesitzersohn, der Hotelkoch und ein Freund des Hotelbesitzersohns, die alle vorne an der Theke standen. Der Hotelbesitzersohn war für zwei Wochen fürs Hotel zuständig, erzählte er. Die Eltern, wie passend, hätten silberne Hochzeit und seien von den Kindern in den Urlaub geschickt worden. Eigentlich würde er studieren, aber was und wo habe ich vergessen.
Ob er denn auch Klavier spielen würde, fragte der Mann. Ja ja, schon, aber eher so Sonatinen und sowas, nichts Aufregendes, sagte der Hotelbesitzersohn. Sonatinen!, sagten wir. Ja, wenn wir das gewusst hätten, da hätten wir ihn ans Klavier gesetzt, denn die Schwiegermutter liebt Sonatinen über alles. Wir schickten den Hotelbesitzersohn Noten holen, dann ging es ans Klavier, immer abwechselnd, manchmal mit Ukulele, manchmal mit Gesang, manchmal nur Klavier.
„Kommt, wir mixen Drinks“, hieß es irgendwann, und dann saßen wir nicht nur abwechselnd am Klavier, sondern liefen auch abwechselnd zu zweit an die Hotelbar, um Drinks zu mixen. Wobei das im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen ist. Den Drink, den der Mann zusammen mit dem Hotelbesitzersohn nach ausführlicher Begutachtung des Sortiments „mixte“, hieß Single Malt, war aber auch gut.
So ging das weiter. Der Mann, der Hotelbesitzersohn und ich spielten Klavier oder Ukulele, der Koch und der Hotelbesitzersohnfreund lauschten und äußerten Publikumswünsche. Es wurde ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr. Der Koch gähnte und verabschiedete sich. Es wurde vier Uhr. „Verdammt, das wird hart morgen“, sagte der Hotelbesitzersohn. Wir brummelten mitleidsvoll Zustimmung. Um halb fünf wurde entschieden, dass man jetzt vielleicht doch mal ins Bett gehen könnte. Gute Nacht, bis morgen, war sehr schön.
Wann der Wecker am nächsten Morgen klingelte, weiß ich nicht mehr. Ich nörgelte brummelnd vor mich hin, der Mann saß halbwegs aufrecht im Bett. „Kommste mit?“ fragte er mich. Ich stellte mir kurz vor, am Frühstückstisch zu sitzen, wusste aber, dass ich keinen Bissen runter bekommen würde und entschied mich spontan dagegen. „Neeee“, brummelte ich, zog die Decke noch mal energisch über beide Ohren, ließ den Mann alleine zum Frühstücken gehen und schlummerte selig wieder ein.
„Es gibt kein Frühstück“, hörte ich als nächstes, als der Mann wieder ins Bett kroch.
„Hm?“
„Gibt kein Frühstück“, wiederholte er.
„Was?“
„Wir haben da unten jetzt gewartet, aber es kam keiner. Und es war auch nichts aufgedeckt.“
Ich stellte mir das mal vor, die Schwiegereltern, die Kinder, die Enkelkinder, alle erwartungsfroh um halb zehn im Frühstücksraum versammelt, in Erwartung von Brot und Brötchen, Schinken, Käse, Marmelade und Ei und da ist nichts. Noch nicht mal Kaffee. Ausgerechnet die Schwiegereltern, die wir am Abend vorher noch in zähen Verhandlungen dazu überreden konnten, das Frühstück von neun Uhr auf halb zehn zu verschieben. Die Schwiegereltern, die bei jedem Besuch jeden Abend nachfragen, wann wir denn am nächsten Tag frühstücken wollten, worauf wir jedes Mal „Na, dann, wenn wir wach sind“ antworten. Bei der Frühstücksplanung offenbaren sich die wahren Generationskonflikte. Und jetzt gab es gar kein Frühstück und keiner wusste, warum.
Also, keiner außer uns.
„Ernsthaft jetzt?“ fragte ich.
„Ja, ernsthaft.“
Und dann schliefen wir noch ein bisschen.
Der Hotelbesitzersohn hatte verschlafen. Und weil er verschlafen hatte, konnte die Frühstücksaufdeckdame nicht ins Hotel. Und weil die Frühstücksaufdeckdame nicht ins Hotel konnte, gab es kein Frühstück fürs ganze Hotel.
Alles nur, weil da ein Klavier stand, und der Hotelbesitzersohn Sonatinen vorspielen musste und das dann wieder so furchtbar in eine Musik- und Trinkorgie ausartete. So ist das eben manchmal.