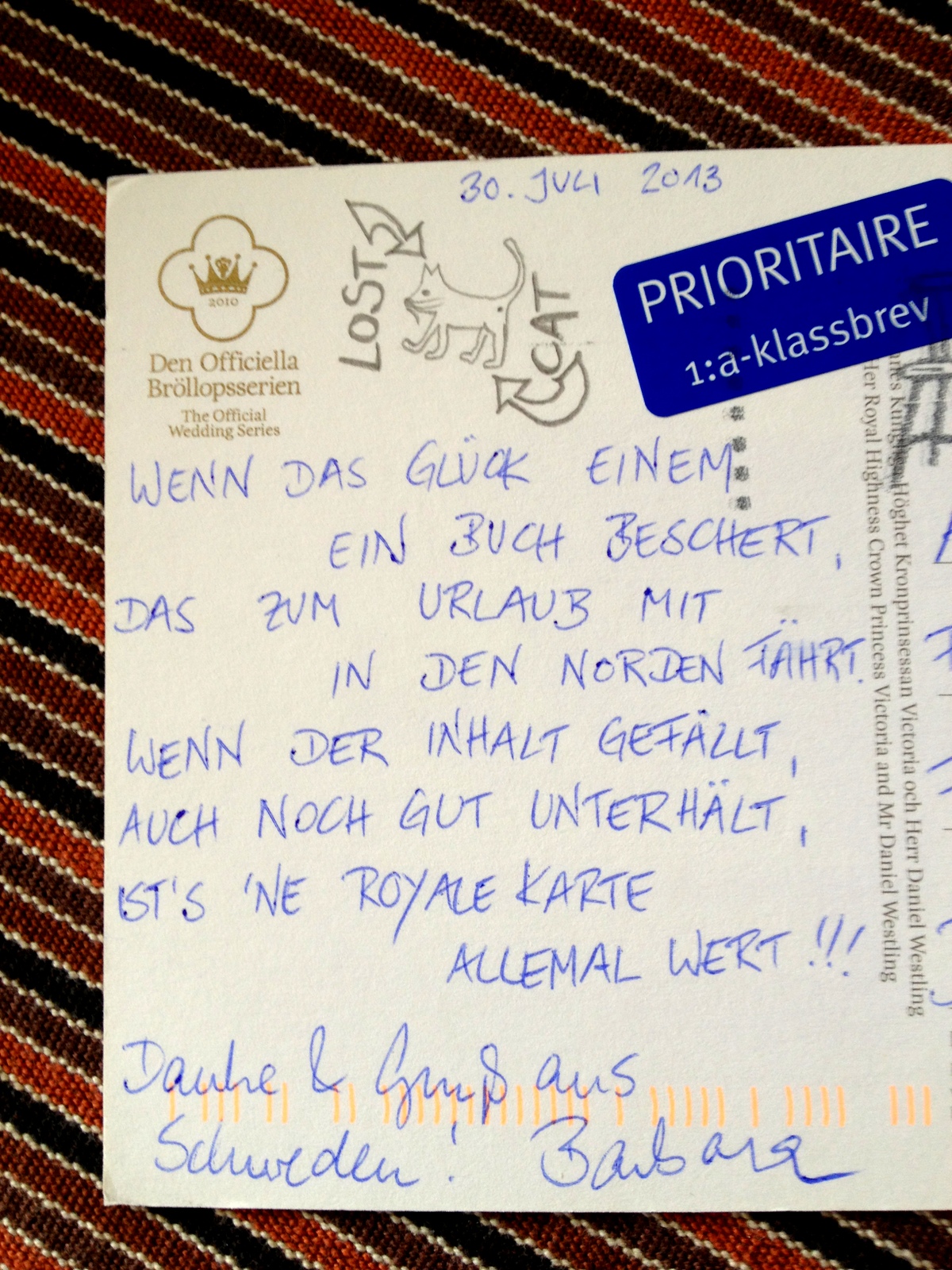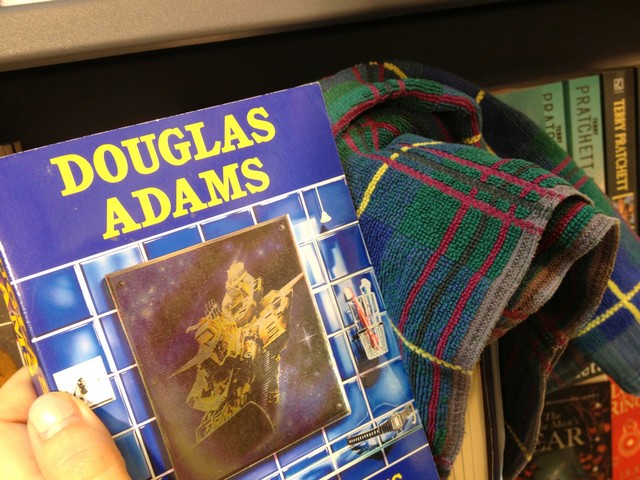Das ist nicht der erste Beitrag, der zu diesem Schmuckstück deutscher Beraterschreibkunst geschrieben wurde, aber ich konnte die Finger leider doch nicht davon lassen.
Was bisher geschah: Wilko Steinhagen brachte mich via Twitter auf diesen Artikel, ich sprach eine dringende Leseempfehlung auf Facebook aus, der einige Leute folgten. Dann schrieb erst Ninia etwas darüber und dann Kiki. (Jetzt können Sie hier weiter lesen.)
„Tipps, wie sich Frauen in sozialen Netzwerken noch besser präsentieren“ bekommt man heute auf deutsche startups zu lesen, präsentiert von Peer Bieber, seines Zeichens Gründer von TalentFrogs.de, außerdem Berater, Social-Media-Experte und weiß-der-Teufel-was-noch. Wichtige Hinweise also, extra für uns Frauen, die wir ja schon einiges nicht ganz verkehrt machen, aber eben auch noch nicht alles ganz richtig. Aber dafür haben wir ja den Erklärpeer, der uns allen nur helfen will. Also uns Frauen. Männer brauchen das nicht. Oder jedenfalls nicht so doll.
Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, den Artikel auseinanderzunehmen, denn er bietet so viele Ansätze, dass man sich gar nicht für den schönsten entscheiden kann.
Fangen wir mal bei den fünf Unterschieden an. Frauen laden weniger oft ein Profilbild hoch, sie tendieren eher dazu, ihre Softskills als die „harten Fakten“ zu benennen, sie interessieren sich in ihrer Freizeit für „klischeehaft weibliche“ Dinge, haben nicht so viele Kontakte und haben angeblich öfter (als Männer?) Lücken im Lebenslauf.
Nun gut, den ersten und letzten Punkt kann ich so aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, allerdings bin ich auch kein Personaler und sichte nicht täglich hunderte von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben. Mein Lebenslauf ist lückenlos, ich bin außerdem der letzte Mensch, der sich scheut, Bilder von mir hochzuladen, aber ich kann auch nur von mir selbst sprechen.
Dass ich nicht so viele Kontakte habe, wenn es denn so ist, liegt tatsächlich daran, dass mir nichts daran liegt, einen Kontaktberg von Leuten, die ich sowieso nicht kenne, anzuhäufen. Die Kontakte, die ich habe, und dazu zähle ich auch den ein oder anderen Recruiter, habe ich sorgsam ausgesucht. Ich gucke mir die Leute und ihre Profile eben an, wäge ab, ob mir der Kontakt zu dieser Person sinnvoll erscheint und drücke dann entweder auf „Bestätigen“ oder „Ignorieren“. Selbst wenn Peer Bieber mir weismachen will, dass sich potentiell JEDER Kontakt VIELLEICHT IRGENDWANN MAL als SUPERNÜTZLICH erweist, sorry, das mag in der Theorie total gut klingen. In der Praxis umgebe ich mich selbst auf eher professionellen Social-Network-Plattformen wie Xing oder LinkedIn bevorzugt mit Leuten, die ich auch irgendwie zuordnen kann, denn nur dann weiß ich auch, wann und warum es sich lohnen könnte, sie anzusprechen.
Dass mir das zum Nachteil gereichen könnte, zweifle ich an. Und die Recruiteranfragen der letzten Monate sprechen auch dagegen.
Da ich über keine nennenswerten sozialen Kompetenzen verfüge, erledigt sich der zweite Punkt für mich sowieso. Meine Liste ist voll mit Hard Skills. Aber man muss dann auch mal hinterfragen, mit was für einem Selbstverständnis Personaler und Recruiter ihre Arbeit machen, wenn sie über einfachste Filterkompetenzen nicht hinauskommen. Für meinen Beruf sind tatsächlich zunächst die harten Fakten sehr entscheidend, das fängt schon bei der Frage der Programmiersprache an. Bei vielen anderen Berufen sieht es aber anders aus. Auf was wird da bitte gefiltert? Word? Excel? Zehnfingerschreiben? Alles Dinge, die man heutzutage voraussetzen sollte und vermutlich sogar voraussetzen kann.
Mag sein, dass der Zustand, den Peer Bieber beschreibt, tatsächlich der Realität entspricht und es ratsam ist, sich schnell ein paar Hard Skills aus den Fingern zu saugen, um die filternden Personaler glücklich zu machen. Ich möchte dem Tipp, sein Profil in dieser Hinsicht zu überprüfen, noch nicht mal widersprechen, aber was für armselige Verhältnisse sind das denn bitte?
Anekdote am Rande: Ich sprach bei der letzten Jobsuche geschlagene anderthalb Stunden mit der Angestellten einer ziemlich großen Jobvermittlungsagentur. Wir gingen alle meine Skills durch, meine Vorstellungen von Aufgaben (Softwareentwicklung, am liebsten mit .NET bzw. C#) und Vertrag (festangestellt, Vollzeit), meine aktuelle Situation (festangestellt, zwei Monate Kündigungsfrist), alles im Detail, fast neunzig Minuten lang. Eines der ersten „Jobangebote“, die ich dann von dieser Agentur bekam, war für eine dreimonatige Projektarbeit mit JavaScript, Beginn in zwei Wochen. Nichts, aber auch GAR NICHTS von dem, was ich der Mitarbeiterin am Telefon erzählt hatte, kam bei diesem Angebot auch nur annähernd zum Tragen.
Was uns anekdotisch und exkursmäßig auch zu einer der Eingangsschockersätze bringt: Frauen können zwar super netzwerken (Lüge: Ich kann überhaupt nicht gut netzwerken!), aber wir kriegen drei Mal weniger Jobangebote. (Oder „Jobofferten“, wie Peer Bieber es auf beraterdeutsch ausdrückt.) Dazu muss aber vielleicht auch mal gesagt werden, dass nach meiner ganz persönlichen groben Schätzung auch zwei Drittel aller Jobangebote, die ich so bekomme, sehr zielsicher an meinem Profil vorbeigehen. Die Insistenz, mit der sich Recruiter an einzelnen Buzzwords festklammern, ohne sich das Gesamtprofil auch nur drei Sekunden lang anzugucken, ist schon beeindruckend und sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Aber weiter. Ich tanze nicht, und Yoga mache ich auch nicht. Würde ich meine Kerninteressen aufschreiben, so würde da „Lesen, Musik, Internet“ stehen. Wenig aussagekräftig, aber vermutlich zumindest nicht klischeehaft weiblich. Puh. Selbst „Kochen“ ist vermutlich ungefährlicher als „Reiten“, auch wenn „Kochen“ wahrscheinlich jeder von sich behaupten kann, während „Reiten“ tatsächlich sowas wie Disziplin und Ausdauer erfordert. Ganz schlimme Dinge also, im Berufsleben völlig fehl am Platz. Auch das, was ich vom Yoga so höre, scheint mir alles andere als harmlos zu sein und ich habe größten Respekt vor Leuten, die sich nach der Arbeit noch eine Stunde die Muskeln verdehnen, während ich nur auf dem Sofa rumliege und mich für „Politik und Wirtschaft“ interessiere, mich also auf Twitter über „Hart aber fair“ lustig mache.
Auch hier will Peer Bieber vielleicht gar nichts Böses. Er will wirklich nur helfen. Es bleibt sogar zu befürchten, dass er recht hat. Aber auch darauf gibt es nur eine vernünftige Reaktion: WIE BESCHEUERT IST DAS DENN BITTE? Wie billig denken denn Berater, Personaler, Recruiter und wie sie sich noch so nennen, wenn ihnen bei Tanzen, Yoga und Reiten nichts besseres einfällt als die ältesten Klischees der Welt auszupacken? An welcher Stelle gibt es irgendein stichhaltiges Argument dafür, dass „Tanzen“ schlechter ist als „Fitness“, „Reiten“ schlechter als „Schwimmen“ und „Yoga“ blöder als „Golf“? Wer hat das entschieden und vor allem WARUM ZUR HÖLLE HAT DEN NIEMAND SOFORT MINUTENLANG AUSGELACHT?
Noch wichtiger: Wird mir hier wirklich erzählt, dass sich das System eben nicht an mich anpasst und ich mich dementsprechend bitteschön ans System anzupassen habe? Als guter Tipp? Tanzen und Yoga als die ultimative Erklärung dafür, warum Frauen halt keine Karriere machen können? Weil wir die fucking falschen Hobbys haben?
Wäre ich Berater, ich hätte an dieser Stelle zumindest zugegeben, dass das alles bevormundender Patriarchen-Bullshit ist, aber man sich eben selber überlegen muss, ob man das Spielchen mitmacht oder nicht. Soviel Ehrlichkeit sollte machbar sein.
Apropos Ehrlichkeit. Nachdem Peer Bieber uns also gesagt hat, dass wir ein ordentliches und professionelles Bild von uns hochladen, bitte schön keine Lücken im Lebenslauf haben sollten, uns ein paar Hard Skills aus den Fingern saugen und unsere Interessen noch mal gründlichst auf ihre Karrieretauglichkeit überprüfen sollten, kommt er mit dem ultimativen Social-Network-Tipp: Ehrlich bleiben. Denn es fällt selbstverständlich sofort auf, wenn man etwas erfindet, übertreibt oder anderweitig nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat.
An welcher Stelle das ein besonderer Tipp für Frauen sein soll, die ja, wie Peer Bieber selber feststellt, eher zu Untertreibungen neigen und ihr Licht gerne mal unter den Scheffel stellen, bleibt unklar. Und auch dieser Tipp ist ja nicht prinzipiell verkehrt, er hat nur nichts und wieder nichts mit den Problemen von Frauen auf Social-Network-Plattformen zu tun. Es ist ein Hinweis, den jeder beherzigen sollte. Nicht nur bei der Jobsuche, sondern eigentlich so generell im Leben. Es ist außerdem ein Hinweis, der quasi im direkten Widerspruch zu den Ratschlägen steht, sich doch bitte einen lückenlosen Lebenslauf zurecht zu basteln, bei der Angabe der Interessen im Zweifelsfall nicht so ganz die Wahrheit zu sagen und doch bitte auch jeden Hansel als Kontakt zu bestätigen, damit es aussieht, als wäre man mit der ganzen Welt vernetzwerkt und ultrawichtig.
Was Peer Bieber in diesem hilfreichen Artikel präsentiert ist ein Sammelsurium von Selbstverständlichkeiten, die für Männer und Frauen gleichermaßen gelten und Unverschämtheiten, die zwar vielleicht in der Realität wirklich so stimmen, aber trotzdem genau das bleiben: Unverschämtheiten.
Was noch zu sagen bleibt, sind zwei Sachen: In einer Welt, in der Personaler tatsächlich so agieren, wie es Peer Bieber hier beschreibt, bleibt zu hoffen, dass ein ehrliches Profil, das meine Person zeigt und kein auf einen gestrigen Karrierepfad getrimmten Kunstmenschen, eben genau die Personaler und Recruiter geschickt aussiebt, die sowieso kein passendes Jobangebot für mich gehabt hätten. Auch bei der Jobsuche gibt es zwei Seiten, und es ist nicht nur der Arbeitgeber, der entscheidet, ob ich zu ihm passe, sondern auch ich, die entscheidet, ob der Arbeitgeber zu mir passt.
Und zweitens habe ich noch einen verdammt guten Tipp für Peer Bieber: Zeichensetzung ist dein Freund. Immer. Vor allem aber, wenn ich mich als Firmengründer und Experte auf einer professionellen Seite mit einem fachlichen Artikel präsentiere. Ich sag ja nur.